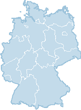Weitere Behandlungen an den Augen
Operation | Therapie am Auge | Kleine Eingriffe
Allgemeines
Neben den klassischen Operationen und anderenMaßnahmen werden in der Augenheilkunde auch viele weitere Behandlungen durchgeführt, die sich nicht in einen größeren Teilbereich der Eingriffe in der Augenmedizin einordnen lassen. Es handelt sich teilweise um sehr spezielle oder neuartige Therapieformen. Einige wichtige Behandlungen, die dazu zählen, sollen hier kurz vorgestellt werden.- Weitere Behandlungen an den Augen
- Allgemeines
- Die klassischen Gebiete der Augenoperationen
- Weitere Behandlungen an den Augen
- Photodynamische Therapie
- Intravitreale Injektion (Einspritzung von Medikamenten in den Glaskörperraum)
- Punctum Plugs bei trockenem Auge
- Probeentnahme der Schläfenarterie (Arteria-temporalis-Biopsie)
- Lyse bei Gefäßverschluss am Auge
- Intravitreale Injektion
- Grundlagen
- Bei welchen Erkrankungen ist eine Einspritzung von Medikamenten in den Glaskörperraum sinnvoll?
- Welche Wirkstoffe können bei der Injektion in den Glaskörperraum zum Einsatz kommen?
- Werden vor der Injektion Untersuchungen durchgeführt?
- Wie läuft die Behandlung mit der Spritze ins Auge ab?
- Welche Komplikationen können sich durch die Einspritzung in den Augapfel ergeben?
- Was geschieht nach dem Eingriff?
- Welche Erfolgsaussichten bestehen bei der Medikamenteneinspritzung?
- Hinweise zur Kostenübernahme
- Intravitreale Implantate
- Was sind intravitreale Implantate?
- Bei welchen Erkrankungen können Implantate in den Glaskörperraum gesetzt werden?
- Welche Untersuchungen werden vor der Implantation des Medikamententrägers vorgenommen?
- Auf welche Weise wird das Implantat mit dem jeweiligen Wirkstoff eingesetzt?
- Können sich Komplikationen durch den Eingriff ergeben?
- Was erfolgt nach der Implantation?
- Ist das Einsetzen eines intravitrealen Implantats erfolgversprechend?
- Werden die Behandlungskosten von den Krankenkassen übernommen?
- Photodynamische Therapie
- Photodynamische Therapie am Auge - Grundlagen
- Die feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Durchführung der photodynamischen Therapie mit Verteporfin (Visudyne®)
- Wie sollte sich der Patient nach der PDT verhalten?
- Welche Komplikationen können bei der PDT auftreten?
- Erfolgsaussichten der PDT
- Schläfenarterie Biopsie
- Grundsätzliches zur Probeentnahme von Gewebe aus der Schläfenarterie
- Was ist die Horton-Krankheit?
- Welche Symptome kann der Patient bemerken?
- Welche Untersuchungen werden beim Verdacht auf eine Horton-Krankheit durchgeführt?
- Wie wird die Schläfenarterien-Biopsie durchgeführt?
- Welche Komplikationen können bei der Gewebeentnahme auftreten?
- Was kann durch die Probeentnahme der Schläfenarterie erreicht werden?
- Wie läuft die weitere Behandlung der Horton-Erkrankung ab?
- Punctum Plugs
- Grundlagen
- Trockenes Auge (Sicca-Syndrom)
- Welche Symptome können bei Augentrockenheit auftreten?
- Welche Untersuchungen werden vom Augenarzt durchgeführt?
- Welche Behandlungsalternativen des trockenen Auges gibt es?
- Wie werden die kleinen Stöpsel eingesetzt?
- Welche Probleme können bei den Punctum Plugs auftreten?
- Können Punctum Plugs auch wieder entfernt werden?
- Welche Erfolgsaussichten bestehen bei der Behandlung der Augentrockenheit durch Punctum Plugs?
Die klassischen Gebiete der Augenoperationen
Die am häufigsten durchgeführte Augenoperation in Mitteleuropa ist die Operation am Grauen Star (Katarakt-Operation), bei der die getrübte Augenlinse durch eine klare Kunstlinse ersetzt wird. Ebenfalls routinemäßig in den meisten Augenkliniken vorgenommen werden unter anderem Operationen am Grünen Star (Glaukom), Lidoperationen, Glaskörperentfernung (Pars-plana-Vitrektomie, PPV), Operationen zur Tumorentfernung, Operationen bei Verletzungen am Auge, Netzhaut-Laser oder Operation bei Netzhautablösung. Des Weiteren haben beispielsweise auch Tränenwegsoperationen, Schieloperationen und die Hornhauttransplantation eine große Bedeutung. Medizinisch nicht notwendig, aber immer häufiger durchgeführt wird darüber hinaus die Refraktive Chirurgie, bei der z. B. durch eine Laserbehandlung der Hornhaut (meist LASIK) eine Fehlsichtigkeit des Patienten ausgeglichen wird.
Weitere Behandlungen an den Augen
Es gibt neben diesen Standardeingriffen aber auch Behandlungsmaßnahmen der Augenmedizin, die sich nicht ohne weiteres klassifizieren lassen. Dies sind dann oft Therapien, die eher ein geringeres Ausmaß haben, relativ neu sind oder nur bei einer bestimmten, selteneren Erkrankung durchgeführt werden. Abgesehen von den unten beschriebenen Behandlungen finden sich noch viele weitere Möglichkeiten, die bei Krankheiten der Augen zum Einsatz kommen können.Photodynamische Therapie
Die photodynamische Therapie (PDT) kann bei bestimmten altersbedingten Veränderungen der Netzhautmitte durchgeführt werden, bei denen sich schlechte Gefäße neu bilden (feuchte altersbedingte Makuladegeneration, AMD). Es handelt sich bei der PDT um eine Art Laserbehandlung, die über die Aktivierung eines Farbstoffes wirkt. Zur Behandlung werden die Pupillen des Patienten erweitert und eine Kanüle in die Vene gelegt. Über diese wird dann der Wirkstoff Verteporfin (Visudyne®) gespritzt. Etwas später erfolgt dann die Laserbestrahlung der schadhaften Stellen am Augenhintergrund, welche 90 Sekunden dauert. Es kommt zu einer Reaktion des Wirkstoffes, wodurch die Gefäße verödet werden. Damit kann in vielen Fällen die Makuladegeneration aufgehalten werden. Für die folgenden Tage muss der Patient sich gut vor der Sonne schützen, um Schäden durch den Wirkstoff zu verhindern, z. B. eine spezielle Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung tragen.Intravitreale Injektion (Einspritzung von Medikamenten in den Glaskörperraum)
Ebenfalls bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD), aber auch z. B. bei Schäden der Netzhaut durch Zuckerkrankheit (Diabetische Retinopathie) oder bei Infektionen im Auge (Netzhautentzündung = Retinitis, Entzündung des Augeninhalts = Endophthalmitis) kann ein Medikament in den Glaskörper eingespritzt werden (Intravitreale Injektion). Der jeweilige Wirkstoff wird im Rahmen einer kleinen Operation mit einer Hohlnadel durch die Lederhaut bis in die Nähe des zu behandelnden Bereiches gebracht. Oft kann das verabreichte Arzneimittel vom Patienten eine Zeit lang als „tanzende“ Trübungen im Blickfeld wahrgenommen werden. Eine weitere Alternative zur Einspritzung ist das Einsetzen eines Implantats (Intravitreales Implantat) in den Glaskörperraum, von dem aus das Medikament längerfristig abgegeben wird.Punctum Plugs bei trockenem Auge
Eine ganz andere Problematik besteht, wenn ein trockenes Auge vorliegt. Dabei ist entweder zu wenig Tränenflüssigkeit vorhanden, oder die Tränenflüssigkeit hat eine ungünstige Zusammensetzung. Es kommt zum Reibegefühl und Brennen der Augen und in schweren Fällen zu Folgeschäden, z. B. der Hornhaut. In vielen Fällen können trockene Augen durch Tränenersatzmittel (Augentropfen, Augen-Gel) behandelt werden. Bei Erfolglosigkeit können die Tränenkanälchen beziehungsweise deren Eingänge am Lidrand, die Tränenpünktchen, durch Stöpsel (so genannte Punctum Plugs) verlegt werden, damit das wenige Tränenwasser nicht noch abfließt. Sie können vom Augenarzt meist ohne Betäubung unter Vergrößerung eingesetzt werden. Die Augentrockenheit geht dann meist zurück.Probeentnahme der Schläfenarterie (Arteria-temporalis-Biopsie)
Eine Gewebeprobe der Schläfenarterie wird in den meisten Fällen ebenfalls vom Augenarzt entnommen. Diese Biopsie der Arteria temporalis wird beim Verdacht auf eine Krankheit (Morbus Horton) durchgeführt, die unter anderem zur raschen Erblindung führen kann. Beim Morbus Horton kommt es durch körpereigene Ursachen zur Entzündung von bestimmten Blutgefäßen, meist ist die Schläfenarterie mit betroffen und verhärtet und nicht pulsierend tastbar. Die Entzündung kann auch sehr schmerzhaft sein. Um das Fortschreiten aufzuhalten, ist eine hochdosierte Cortison-Behandlung notwendig. Durch die Probeentnahme der Schläfenarterie lässt sich die Erkrankung feststellen oder nahezu ausschließen. In einer kleinen Operation wird ein Stück der Arterie entnommen und zur feingeweblichen Untersuchung (Histologie) in ein Labor geschickt. Dort wird entweder die Erkrankung nachgewiesen, oder es findet sich keine Gefäßveränderung, was den Morbus Horton unwahrscheinlich macht.Lyse bei Gefäßverschluss am Auge
Ebenfalls nicht direkt am Auge wird die Lyse-Therapie (Fibrinolyse) durchgeführt. Sie kann bei frischen Gefäßverschlüssen (Arterienverschlüsse) am Augenhintergrund erfolgen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, keine Gegenanzeigen vorliegen und der Verschluss noch nicht mehr als 6 Stunden zurückliegt. Die Lyse wird nicht durch Augenärzte, sondern durch Ärzte der Inneren Medizin durchgeführt.Letzte Aktualisierung am 09.12.2018.