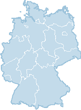Intravitreale Implantate
Lesezeit: 3 Min.
Medikamententräger im Glaskörper | Glaskörperraum
Was sind intravitreale Implantate?
Ein intravitreales Implantat ist ein Kügelchen, Plättchen oder Stäbchen, das in den Glaskörperraum des Auges eingesetzt wird. Im Implantat befindet sich ein Medikament, das langsam in das Augeninnere abgegeben wird. Verschiedene Wirkstoffe können über einen solchen Medikamententräger verabreicht werden, um zur Bekämpfung einiger Erkrankungen zu dienen. Zur Implantation ist eine kleine Operation notwendig.Inhaltsverzeichnis
- Weitere Behandlungen an den Augen
- Allgemeines
- Die klassischen Gebiete der Augenoperationen
- Weitere Behandlungen an den Augen
- Photodynamische Therapie
- Intravitreale Injektion (Einspritzung von Medikamenten in den Glaskörperraum)
- Punctum Plugs bei trockenem Auge
- Probeentnahme der Schläfenarterie (Arteria-temporalis-Biopsie)
- Lyse bei Gefäßverschluss am Auge
- Intravitreale Injektion
- Grundlagen
- Bei welchen Erkrankungen ist eine Einspritzung von Medikamenten in den Glaskörperraum sinnvoll?
- Welche Wirkstoffe können bei der Injektion in den Glaskörperraum zum Einsatz kommen?
- Werden vor der Injektion Untersuchungen durchgeführt?
- Wie läuft die Behandlung mit der Spritze ins Auge ab?
- Welche Komplikationen können sich durch die Einspritzung in den Augapfel ergeben?
- Was geschieht nach dem Eingriff?
- Welche Erfolgsaussichten bestehen bei der Medikamenteneinspritzung?
- Hinweise zur Kostenübernahme
- Intravitreale Implantate
- Was sind intravitreale Implantate?
- Bei welchen Erkrankungen können Implantate in den Glaskörperraum gesetzt werden?
- Welche Untersuchungen werden vor der Implantation des Medikamententrägers vorgenommen?
- Auf welche Weise wird das Implantat mit dem jeweiligen Wirkstoff eingesetzt?
- Können sich Komplikationen durch den Eingriff ergeben?
- Was erfolgt nach der Implantation?
- Ist das Einsetzen eines intravitrealen Implantats erfolgversprechend?
- Werden die Behandlungskosten von den Krankenkassen übernommen?
- Photodynamische Therapie
- Photodynamische Therapie am Auge - Grundlagen
- Die feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
- Welche Untersuchungen führt der Augenarzt durch?
- Durchführung der photodynamischen Therapie mit Verteporfin (Visudyne®)
- Wie sollte sich der Patient nach der PDT verhalten?
- Welche Komplikationen können bei der PDT auftreten?
- Erfolgsaussichten der PDT
- Schläfenarterie Biopsie
- Grundsätzliches zur Probeentnahme von Gewebe aus der Schläfenarterie
- Was ist die Horton-Krankheit?
- Welche Symptome kann der Patient bemerken?
- Welche Untersuchungen werden beim Verdacht auf eine Horton-Krankheit durchgeführt?
- Wie wird die Schläfenarterien-Biopsie durchgeführt?
- Welche Komplikationen können bei der Gewebeentnahme auftreten?
- Was kann durch die Probeentnahme der Schläfenarterie erreicht werden?
- Wie läuft die weitere Behandlung der Horton-Erkrankung ab?
- Punctum Plugs
- Grundlagen
- Trockenes Auge (Sicca-Syndrom)
- Welche Symptome können bei Augentrockenheit auftreten?
- Welche Untersuchungen werden vom Augenarzt durchgeführt?
- Welche Behandlungsalternativen des trockenen Auges gibt es?
- Wie werden die kleinen Stöpsel eingesetzt?
- Welche Probleme können bei den Punctum Plugs auftreten?
- Können Punctum Plugs auch wieder entfernt werden?
- Welche Erfolgsaussichten bestehen bei der Behandlung der Augentrockenheit durch Punctum Plugs?
Bei welchen Erkrankungen können Implantate in den Glaskörperraum gesetzt werden?
Medikamente im Glaskörper können bei einigen Krankheiten nützlich sein. Oftmals reicht es aus, sie lediglich in den Glaskörperraum einzuspritzen. Das Einsetzen von Implantaten bietet jedoch den Vorteil, dass eine längerfristige Wirkung erzielt wird. Wie bei der Einspritzung von Medikamenten wird zudem noch direkt am Zielort eine Wirkung ausgeübt.Das Antivirus-Mittel Ganciclovir kann beispielsweise als Implantat eingesetzt werden. Der Handelsname dieses Implantats ist Vitrasert®. Nützlich ist das Präparat vor allem bei einer Viruserkrankung der Netzhaut durch das Zytomegalie-Virus (CMV). Bei einer solchen CMV-Retinitis, die vor allem in Verbindung mit AIDS auftritt, kommt es zum Absterben von Bereichen der Netzhaut. Eine Erblindung kann die Folge sein. Durch den Wirkstoff Ganciclovir kann die Netzhautentzündung oft gestoppt werden.
Neben diesen Arzneimitteln können noch weitere Wirkstoffe als Implantat in den Glaskörperraum gesetzt werden. Dies wird jedoch sehr selten oder nur probeweise durchgeführt.
Ein Implantat zum Einführen in den Glaskörperraum ist nur wenige Millimeter groß. Die Abmessungen variieren von Präparat zu Präparat.
Welche Untersuchungen werden vor der Implantation des Medikamententrägers vorgenommen?
In vielen Fällen ist der Patient, bei dem das Implantat in das Auge gesetzt werden soll, dem behandelnden Augenarzt schon bekannt. Dennoch müssen vor der Implantation einige Untersuchungen erfolgen. Ein Sehtest sollte durchgeführt werden. Der Augenhintergrund sollte vom Augenarzt noch einmal genau betrachtet werden. Dazu ist eine Erweiterung der Pupille mit bestimmten Augentropfen erforderlich. Darüber hinaus wird meist der Augendruck gemessen. Bei Makuladegeneration (AMD) und Diabetischer Retinopathie wird eine Gefäßdarstellung am Augenhintergrund durchgeführt (Fluoreszenzangiographie). Verschiedene andere Untersuchungen sind je nach der Erkrankung notwendig.Auf welche Weise wird das Implantat mit dem jeweiligen Wirkstoff eingesetzt?
Bevor die Operation erfolgt, sollten Medikamente zur Blutgerinnungshemmung abgesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise Marcumar® und Aspirin®. Dies sollte jedoch mit dem Arzt abgesprochen werden.Die operative Implantation erfolgt meist in örtlicher Betäubung. Es ist bei bestimmten Umständen auch möglich, eine Vollnarkose durchzuführen.
Über einen kleinen Schnitt oder einen Einstich mit einer Kanüle wird der Augapfel beziehungsweise der Glaskörperraum eröffnet. Das kleine Implantat kann dann (z. B. über eine Spezialkanüle) in den Glaskörper eingeführt werden. Die Lage des Medikamententrägers und die Netzhaut können dann mittels eines Vergrößerungsglases noch einmal beurteilt werden.
Können sich Komplikationen durch den Eingriff ergeben?
Besonders durch die Eröffnung der Augapfelwand kann es zu einigen Komplikationen kommen. So sind Blutungen und Infektionen möglich. Manchmal können sie so schwerwiegend sein, dass sie zu einer dauerhaften Sehverschlechterung oder im schlimmsten Fall bis zur Erblindung oder zum Verlust des Auges führen können. Netzhautablösungen können entstehen. Nicht selten kommt es zur Schädigung beziehungsweise Eintrübung der Augenlinse. Der Augeninnendruck kann steigen. Es kann zu Schatten im Glaskörper kommen, die als so genannte Mouches volantes („tanzende Mücken“) wahrgenommen werden können.Was erfolgt nach der Implantation?
Am Tag nach der Operation wird eine Augenuntersuchung durchgeführt, um einen Sehtest vorzunehmen und den Augenhintergrund zu beurteilen. Der Arzt erkennt das kleine Implantat im Augapfel vor der Netzhaut. Auch in der Folgezeit sind dann weitere Kontrolluntersuchungen notwendig.Oftmals werden jeweils in bestimmten zeitlichen Abständen neue Implantate eingesetzt, z. B. bei Vitrasert® normalerweise alle sechs Monate. Die alten Medikamententräger brauchen nicht herausgeholt zu werden beziehungsweise lösen sich langsam von selbst auf.
Ist das Einsetzen eines intravitrealen Implantats erfolgversprechend?
Durch das Implantat im Glaskörperraum, das das jeweilige Medikament langsam abgibt, ist oft eine effektive Behandlung der Erkrankung möglich. Allerdings kommen auch Fälle vor, in denen es zu keiner Verbesserung oder sogar zu einer Verschlechterung des Befundes kommt. Vorteil des Implantats gegenüber anderen Verfahren ist die kontinuierliche Abgabe des Wirkstoffs über Wochen und Monate.Werden die Behandlungskosten von den Krankenkassen übernommen?
Ob die Kosten für die intravitreale Implantation übernommen werden, richtet sich nach dem Einzelfall. Teilweise sind die Wirkstoffe zur Implantation in den Glaskörper in Deutschland nicht oder noch nicht zugelassen. Daher sollte der Patient vor der Behandlung mit seiner Krankenversicherung in Verbindung treten, um die Kostenfrage zu klären.Letzte Aktualisierung am 12.12.2018.