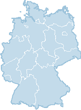Elektrophysiologische Untersuchungen
Unter dem Begriff der elektrophysiologischen Untersuchungen wird eine Gruppe von diagnostischen Methoden zusammengefasst. Diesen Vorgehensweisen ist gemeinsam, dass die Sehfunktion beziehungsweise die Weiterleitung der Sehinformation anhand von elektrischen Signalen überprüft wird, welche gezielt durch bestimmte Lichtreize hervorgehoben werden können. Die gängigen elektrophysiologischen Untersuchungen sind visuell evozierte Potentiale (VEP), das Elektroretinogramm (ERG) und das Elektrookulogramm (EOG).
VEP = Visuell evozierte Potentiale
Mit diesem Test soll die Übertragung der aufgenommenen visuellen Informationen vom Auge bis zur Hirnrinde (Sehrinde) im Hinterkopfbereich geprüft werden. Dazu werden Elektroden am Hinterkopf befestigt, die die Impulse aus dem hinteren Hirnbereich aufzeichnen. Die Erhebung visuell evozierter Potentiale ist damit im Prinzip eine EEG-Untersuchung (Elektroenzephalogramm) mit besonderen auslösenden Reizen. Dem Patienten werden kurzzeitige Lichtreize präsentiert. Dies können z. B. Blitze sein oder Schachbrettmuster, die schnell hin und her wechseln, also dass die schwarzen Felder in schneller Folge zu weißen werden und umgekehrt. Die EEG-Wellen werden aufgezeichnet.
Hierbei ergibt sich das Problem, dass in einer einzelnen Aufzeichnung die Erregung der Sehrinde nicht stark genug ist und von vielen anderen Impulsen im Gehirn überlagert wird. Wird jedoch vielmals ein solches visuell evoziertes Potential erhoben, so können die einzelnen gewonnenen Kurven übereinander gelegt werden. Da immer im gleichen zeitlichen Abstand nach dem Sehreiz die Erregungswelle der Sehrinde auftritt, wird diese umso höher, je mehr Kurven übereinander gelegt werden. Die normale Leitungsgeschwindigkeit, bis die Erregung die Sehrinde erreicht, beträgt um die 100 Millisekunden (0,1 Sekunde).
Bei einem zeitlich verzögerten Auftreten der Welle oder bei einer Abschwächung liegt (sofern die Sehschärfe nicht deutlich herabgesetzt ist) eine Schädigung des Sehnervs oder der Nervenbahnen im Gehirn vor, die den Sehreiz weiterleiten. Deshalb wird die VEP-Untersuchung am häufigsten dann vorgenommen, wenn der Verdacht auf eine Sehnerventzündung (Neuritis nervi optici, Retrobulbärneuritis) besteht.
ERG = Elektroretinogramm
Beim Elektroretinogramm (ERG) wird die Reizantwort der Netzhaut auf eintreffendes Licht gemessen. Die Netzhaut ist die Schicht der Zellen im Auge, die das eintreffende Licht in elektrische Nervenimpulse umwandeln. Meist erfolgt ein so genanntes Helligkeits-ERG, also das ERG bei Setzen eines allgemeinen Lichtreizes. Dies kann in heller Umgebung (photopisch) oder im abgedunkelten Raum (skotopisch) vorgenommen werden. Weitere Möglichkeiten sind das Muster-ERG (meist mit Schachbrettmustern) und das multifokale (an verschiedenen Stellen der Netzhaut abgenommene) ERG.
Die elektrischen Potentiale müssen auch hier von Elektroden aufgenommen werden. Dazu werden spezielle Ringelektroden, die sich innerhalb von Kontaktlinsen befinden, auf das Auge aufgesetzt. Die Gegenelektroden werden auf die Haut aufgesetzt. Nun kann die Messung der elektrischen Erregung bei den jeweiligen Lichtreizen erfolgen.
Es ergibt sich durch die Messung ein spezifisches Wellenmuster. Wenn dieses abgeschwächt oder verzögert ist, liegt eine Erkrankung der Netzhaut vor. Im Wesentlichen können durch das Helligkeits-ERG zwei Erkrankungen diagnostiziert werden. Die eine davon ist die Erbkrankheit Retinopathia pigmentosa, die mit allmählicher Einengung des Gesichtsfelds bis hin zur Erblindung einhergeht. Die andere ist die Siderose, bei der es nach einer Verletzung mit einem Eisensplitter zu toxischen Netzhautschäden durch das Eisen kommt. Beim Muster-ERG können Schädigungen der inneren Netzhautschichten und des Sehnervs von anderen Erkrankungen unterschieden werden.
EOG = Elektrookulogramm
Beim Elektrookulogramm (EOG) macht man sich den Umstand zunutze, dass das Auge einen elektrischen Pluspol und einen Minuspol besitzt. Die vorne liegende Hornhaut ist positiver geladen im Vergleich zur Pigmentzellschicht der Netzhaut. Bei heller Umgebung ist der Unterschied der Ladung größer als in einer dunklen Umgebung. Das Verhältnis der Potentiale verändert sich wiederum bei bestimmten Netzhauterkrankungen.
Zur Ableitung des EOG werden Elektroden in der Umgebung des Auges am Schläfenbereich auf die Haut gesetzt. Der Patient muss nun bestimmte Augenbewegungen zwischen zwei Lichtquellen durchführen, wozu der Untersucher die Anweisung gibt. Gemessen wird das Potentialverhältnis zwischen dunkler und heller Umgebung. Normalerweise ergibt sich ein Quotient mit einem Wert über 1,8.
Ist dieser Wert vermindert, so können Schäden an der Pigmentzellschicht der Netzhaut aufgezeigt werden, wie sie beispielsweise durch Medikamenteneinwirkung oder bei bestimmten Formen zugrunde gehender Netzhautzellen (z. B. vitelliforme Makuladystrophie) entstehen.
Letzte Aktualisierung am 04.10.2022.