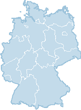Gesichtsfelduntersuchung (Perimetrie)
Ein eingeschränktes Gesichtsfeld kommt bei einigen Erkrankung vor
Grundlagen der Perimetrie
Für einige Erkrankungen, die das Sehvermögen betreffen, ist das Anlegen eines Gesichtsfeldes zur Diagnose oder Verlaufskontrolle sinnvoll (Perimetrie). Grundprinzip ist es, dass das Auge einen Punkt in gerader Richtung fixiert und aufleuchtende Punkte weiter außen wahrnehmen soll. Das ermittelte Gesichtsfeld wird als Abbildung auf einem Papierbogen oder auch digital festgehalten.
Es werden hauptsächlich zwei Methoden der Gesichtsfelduntersuchung unterschieden.
Kinetische Gesichtsfelduntersuchung
Bei der kinetischen Gesichtsfeldprüfung werden auf dem halbkugelförmigen Schirm Lichtpunkte von außen herangeführt, die der Patient erkennen soll. Der Patient macht sich mittels eines Druckknopfs, über den ein Geräusch erzeugt wird, bemerkbar, um anzugeben, ab wann er den Lichtpunkt sieht. Die Steuerung der Lichtquelle kann vom Untersucher selbst durchgeführt werden. Dieser trägt auch auf einem Blatt Papier die äußersten Punkte ein, an denen die Lichtmarke gesehen wird, und verbindet diese später mit einer Linie, um die Graphik anschaulich zu machen. Es können verschiedene Lichtstärken und Größen für die Lichtpunkte eingestellt werden, um die Empfindlichkeit des Sehens in verschiedenen Bereichen zu testen.
Statische Gesichtsfelduntersuchung
Bei der statischen Gesichtsfelduntersuchung werden die Lichtpunkte nicht bewegt, sondern direkt an festen Punkten auf dem Schirm kurzzeitig zum Aufleuchten gebracht. Die Helligkeit kann variiert werden, so dass die Empfindlichkeit einzelner Bereiche gut getestet werden kann. Der Patient muss wiederum einen Knopf drücken, um zu signalisieren, dass der Lichtpunkt erkannt wurde. In der Regel erfolgt die statische Gesichtsfeldprüfung heutzutage computergesteuert (z. B. am „Octopus“), es gibt auch noch manuell steuerbare Geräte. Das ermittelte Gesichtsfeld kann auf einem Ausdruck mit Graustufen oder Zahlenwerten dargestellt werden.
Vorteil der statischen gegenüber der kinetischen Methode ist die genauere Darstellung, so dass kleine Gesichtsfeldausfälle (z. B. bei einem Grünen Star) besser festgestellt werden können. Größere, weiter außen liegende Gesichtsfeldausfälle können dagegen oft einfacher mit der kinetischen Untersuchung festgestellt werden.
Amsler-Netz
Neben diesen eigentlichen Verfahren gibt auch der Amsler-Test (das so genannte Amsler-Netz) Auskunft über das Gesichtsfeld, zumindest im zentralen Bereich. Es handelt sich beim Amsler-Test um ein Gitternetz, das der Patient mit einem Auge betrachtet und dabei einen mittigen Punkt fixiert. Hier kann er dem Untersucher beschreiben oder selbst eintragen, in welchen Bereichen das Sehen ausgefallen, abgeschwächt oder verzerrt ist. So hat der Amsler-Test nicht nur bei Gesichtsfeldausfällen, sondern vor allem auch bei Netzhauterkrankungen mit verzerrtem Sehen wie beispielsweise der Makuladegeneration eine gute Aussagekraft.
aktualisiert am 09.12.2018

Lektor, Arzt, Medizinredakteur