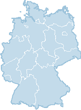Entfernung des Auges | Enukleation
Lesezeit: 4 Min.
Augenentfernung | Kunstauge | Augenprothese
Allgemeines zur Entfernung des Auges und zum Kunstauge
Bei schweren Schäden des Auges kann eine Entfernung des gesamten Organs notwendig werden. Dies kann die Ausbreitung der Schädenverhindern und kann den Patienten von Schmerzenbefreien. Je nachdem, in welchem Ausmaß die Augenentfernung erfolgt, spricht der Augenarzt von Enukleation, Eviszeration oder Exenteration. Ein Kunstauge (Augenprothese) kann angefertigt werden, um zumindest einen kosmetischen Ersatz für das entfernte Auge zu bieten.Inhaltsverzeichnis
- Allgemeines zur Entfernung des Auges und zum Kunstauge
- In welchen Fällen kann eine Entfernung des Auges notwendig werden?
- Vorbereitungen einer Entfernung des Auges
- Die Operation zur Entfernung eines Auges
- Welche Komplikationen können auftreten?
- Was geschieht nach der Operation?
- Über das Kunstauge (Augenprothese)
In welchen Fällen kann eine Entfernung des Auges notwendig werden?
Allgemein kann gesagt werden, dass ein nicht mehr intaktes Auge dann herausgenommen wird, wenn die zu erwartenden Folgeprobleme und Beschwerden bei Belassung gravierender sind als die Vorteile.Schwerwiegende Schäden am Auge können durch verschiedene Ursachen entstehen. Bei Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) oder Blutgefäßverschlüssen kann es beispielsweise zu einer starken Neubildung von Gefäßen kommen, die zu Blindheit und starker Augendruckerhöhung führen können (Neovaskularisationsglaukom). Der Patient leidet oft unter Schmerzen am betroffenen Auge. Auch schwere Verletzungen können zur Erblindung, zur Schrumpfung des Augapfels (Phthisis bulbi) und zu Schmerzhaftigkeit führen.
Bei ausgeprägten Schäden an einem Auge kann es manchmal dazu kommen, dass das Auge der Gegenseite sich ebenfalls entzündet (Sympathische Ophthalmie). Die Ursache sind Immunprozesse, die sich gegen körpereigenes Gewebe richten. Es kann zur Erblindung auch dieses Auges kommen. Durch eine rechtzeitige Entfernung des ursprünglich geschädigten Auges kann die Ophthalmie des zweiten Auges meist verhindert werden.
Ebenso werden oft Augen herausgenommen, die von einem bösartigen Tumor befallen sind. Bösartige Tumore sind dadurch charakterisiert, dass sie in die Umgebung einwachsen und Tochtergeschwülste (Metastasen) bilden können. Ein häufiger bösartiger Tumor im Auge ist z. B. das maligne Melanom, das sich unter anderem an der Aderhaut, an der Regenbogenhaut oder an der Bindehaut befinden kann. Vom Zellaufbau her entspricht das Melanom am Auge dem so genannten schwarzen Hautkrebs. Im Kindesalter kann ein spezieller bösartiger Tumor der Netzhaut auftreten, das Retinoblastom. Weitere mögliche bösartige Wucherungen des Auges sind Karzinome sowie Tochtergeschwülste von Tumoren, die einen anderen Ursprungsort im Körper haben (Metastasen). Eine Alternative zur operativen Behandlung von Tumoren besteht in der Bestrahlung und in der Chemotherapie.
Vorbereitungen einer Entfernung des Auges
Vor der Entfernung des Auges werden augenärztliche Untersuchungen durchgeführt. Dazu gehören Sehtest und Betrachtung des Augenvorderabschnittes sowie des Augenhintergrundes. Ultraschall, Computertomographie (CT) oder andere bildgebende Verfahren komplettieren den Untersuchungsgang. Der Augenarzt beurteilt noch einmal, ob eine Belassung des Auges nicht doch sinnvoller ist.Das unwiederbringliche Herausnehmen eines Auges ist ein einschneidender Eingriff für den Patienten. Ihm wird eine genügend lange Bedenkzeit gelassen. Bei besonders schweren Verletzungen wird das Auge manchmal aber auch direkt in einer notfallmäßigen Operation entfernt.
Um das Risiko größerer Blutungen zu vermindern, sollten blutgerinnungshemmende Arzneimittel (z. B. Aspirin® oder Marcumar®) in Absprache mit dem Ärzteteam abgesetzt werden.
Die Operation zur Entfernung eines Auges
Der Eingriff erfolgt meist in Vollnarkose. Manchmal ist es auch möglich, die Operation in örtlicher Betäubung durchzuführen.In den meisten Fällen wird eine so genannte Enukleation durchgeführt. Das bedeutet, dass der Augapfel entfernt wird, aber die umgebenden Strukturen innerhalb der Augenhöhle zum größten Teil belassen werden. Zur Enukleation wird die Bindehaut vom Hornhautrand abgetrennt. Die Augenmuskeln und der Sehnerv werden abgeschnitten. Der Augapfel wird dann herausgezogen. Um die entstandene Höhle aufzufüllen, können die Muskelstümpfe in der Augenhöhle vernäht werden und Material eingebracht werden. Verwendet werden kann unter anderem Gewebe aus dem eigenen Körper oder Kunststoff. Die Bindehaut wird dann vernäht.
Manchmal wird eine Exenteration (Exenteratio orbitae) durchgeführt, bei der die kompletten Weichteile mitsamt Augapfel aus der Augenhöhle ausgeräumt werden. Hauptsächlich wird dies bei Tumoren innerhalb der Augenhöhle vorgenommen.
Sehr selten genügt eine Eviszeration. Dabei wird nur der Inhalt des Augapfels herausgeholt.
Nach der operativen Augenentfernung wird eine antibiotische Augensalbe aufgetragen und ein Druckverband angelegt. Dieser kann nach einem Tag durch einen normalen Verband ersetzt werden.
Welche Komplikationen können auftreten?
Nicht selten bestehen nach der Operation Schmerzen. Blutungen, Nachblutungen und Blutergüsse können auftreten. Es kann zu Entzündungen des Gewebes kommen. Wird Kunststoff eingesetzt, um die Lücke in der Augenhöhle zu füllen, so kann es zu Abstoßungsreaktionen kommen. Durch schlecht sitzende oder abgenutzte Augenprothesen können Reizungen oder Entzündungen der Augenhöhle verursacht werden.Was geschieht nach der Operation?
Das entfernte Gewebe wird in ein Labor zur feingeweblichen Untersuchung (Histologie) geschickt. Hier kann der jeweilige Befund noch einmal genau untersucht werden. Bei Tumoren kann festgestellt werden, ob das Tumorgewebe komplett entfernt wurde oder ob es sich über den Rand des herausgenommenen Gewebes erstreckt. Eventuell ist dann eine weitere Operation oder eine andere Therapie erforderlich. Nach der Entfernung des Auges erfolgen zunächst tägliche oder mehrmals tägliche augenärztliche Kontrolluntersuchungen. Später werden sie in größerem zeitlichem Abstand, aber regelmäßig durchgeführt.Nach der Entfernung eines Auges ist ein Sehen natürlich nur noch auf dem anderen Auge möglich. Oft war dieser Zustand jedoch bereits vor dem Eingriff gegeben. Anderenfalls gewöhnt sich der Patient meist schnell daran. Ein räumliches Sehen ist nicht mehr vorhanden, das Gesamt-Gesichtsfeld ist zu einer Seite hin eingeschränkt. Besondere Vorsicht sollte der Betroffene daher unter anderem im Straßenverkehr walten lassen. Der erkrankte oder verletzte Augapfel ist jedoch beseitigt worden, so dass es in den allermeisten Fällen nicht zu weiteren Schäden kommt. Dennoch kann z. B. bei einem Tumor nicht ausgeschlossen werden, dass bereits Tochtergeschwülste bestehen oder Tumorreste an Ort und Stelle weiterwachsen.
Über das Kunstauge (Augenprothese)
Bereits nach einigen Tagen kann an die Stelle des entfernten Auges meist eine vorläufige Augenprothese eingesetzt werden. Diese wird nach wenigen Monaten durch ein endgültiges Glasauge oder Kunststoffauge ersetzt.Augenprothesen werden in speziellen Instituten von so genannten Augenkünstlern (Ocularisten, Augenprothetiker) angefertigt. Das schalenförmige Ersatzauge wird in Handarbeit so hergestellt, dass es möglichst gut die Farbe und Größe des Partnerauges nachahmt. Für den Laien ist im alltäglichen Leben das Kunstauge oft gar nicht als Augenersatz zu erkennen.
Das Kunstauge wird eingesetzt, indem es (unter möglichst keimfreien Bedingungen nach Desinfizieren der Hände) mit einer Hand festgehalten wird, beim Blick nach unten das Oberlid hochgezogen wird und das Kunstauge vorsichtig unter das Oberlid geschoben wird. Dann schaut der Patient nach oben, zieht das Unterlid herab und drückt die Prothese auch unter das Unterlid. Herausgenommen wird die Augenprothese, indem das Unterlid vorsichtig unter den Rand gedrückt wird. Die Prothese fällt dann meist von selbst heraus.
Die Pflege von Kunstaugen wird ähnlich wie bei Kontaktlinsen gehandhabt. Sie werden mindestens täglich in einem speziellen Gefäß mit lauwarmem Wasser oder Salzlösung gereinigt. Wird die Prothese nicht getragen, sollte sie gesäubert und trocken aufbewahrt werden.
Nach unterschiedlich langer Zeit (oft nach ungefähr einem Jahr) kann es notwendig sein, eine neue Augenprothese anzufertigen, da sich Abnutzungserscheinungen zeigen.
aktualisiert am 17.03.2023
Autoren

Lektor, Arzt, Medizinredakteur