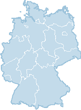Hornhauttransplantation
Perforierende Keratoplastik | Transplantation Hornhaut
Grundlagen zur Hornhauttransplantation
Krankheits- oder verletzungsbedingte Schäden der Hornhaut sind manchmal sehr schwerwiegend. Wenn sie nicht auf andere Weise behandelt werden können, muss oft eine Hornhauttransplantation (Keratoplastik) durchgeführt werden. Ziel der Operation ist es, wieder eine klare Sicht zu schaffen und die Stabilität des Augapfels zu gewährleisten.- EDTA-Abrasio
- Operationen an der Hornhaut | Hornhautchirurgie
- Hornhaut und Hornhautchirurgie
- Über die Hornhaut
- Welche Operationen können an der Hornhaut vorgenommen werden?
- Fremdkörperentfernung an der Hornhaut
- Hornhautnaht / Operation bei Verletzung
- Hornhauttransplantation
- Refraktive Chirurgie
- Hornhautschnitt bei Operationen anderer Bereiche der Augen
- EDTA-Abrasio
- Welche allgemeinen Risiken bestehen bei chirurgischen Maßnahmen an der Hornhaut?
- Hornhauttransplantation
Die Hornhaut des Auges
Die Hornhaut ist die vordere äußere Hülle des Auges. Die normale Hornhaut ist glatt und durchsichtig. Sie weist eine Krümmung auf, so dass eine bestimmte Brechkraft erreicht wird. Zusammen mit der Augenlinse werden die einfallenden Lichtstrahlen so gebündelt, dass auf der Netzhaut am Augenhintergrund ein scharfes Bild entsteht. Im Wesentlichen besteht die Hornhaut aus drei Schichten: dem äußeren, dünnen Epithel (das bei Schäden meist schnell wieder verheilt und aufgebaut wird), dem mittleren Hauptanteil (Stroma) und dem inneren, dünnen Endothel.Die Hornhaut ist, obwohl sie nur etwa 0,5 bis 0,7 Millimeter dick ist, im Allgemeinen verhältnismäßig belastungsfähig und erholungsfähig. Durch verschiedene Einflüsse kann die Hornhaut jedoch so stark geschädigt werden, dass sie mit herkömmlichen Methoden nicht ausreichend behandelt werden kann. Dazu gehören beispielsweise:
- mechanische Verletzungen, insbesondere, wenn die Hornhaut dabei durchbohrt wird
- Verätzungen
- Verbrennungen
- Schwere bakterielle Hornhautentzündungen beziehungsweise Hornhautgeschwüre
- Manche schwerwiegende Entzündungen und Geschwüre durch andere Ursachen
- Erbkrankheiten mit Hornhautschädigung, z. B.
- Fuchs-Endotheldystrophie (Absterben der inneren Zellschicht mit Quellung der Hornhaut)
- Weitere so genannte Hornhautdystrophien
Bei manchen Arten von Schäden der Hornhaut, z. B. oberflächlicher Vernarbung oder beim Keratokonus, kann es angezeigt sein, nur eine äußere Schicht der Hornhaut zu entfernen. Diese wird dann durch einen Anteil einer Spenderhornhaut ersetzt (lamelläre Keratoplastik).
Über die Spenderhornhaut
Die Hornhäute, die für eine Transplantation zur Verfügung stehen, stammen von Verstorbenen, die einer solchen Organspende zugestimmt haben. Auch möglich ist die Hornhautübertragung bei Zustimmung der Angehörigen des Toten. Die Spenderhornhäute werden durch eine so genannte Hornhautbank verwaltet und auf die Empfänger verteilt. Sie werden in einer Nährflüssigkeit gelagert, damit sie länger intakt bleiben. Das Organ sollte möglichst gut zum Gewebetyp des Empfängers passen, um eine mögliche Abstoßungsreaktion unwahrscheinlich zu machen. Oft muss der Patient deshalb relativ lange auf eine geeignete Hornhaut warten. Bei der so genannten Keratoplastik à chaud wird wegen der drängenden Zeit allerdings direkt eine beliebige Hornhaut eingesetzt.Voraussetzungen beim Empfänger
Damit eine Hornhautübertragung langfristig Erfolge beim Patienten zeigt, müssen einige Voraussetzungen zutreffen. So sollten die Lider intakt sein und vollständig schließen, der Tränenfilm ausreichend sein und der Augendruck normale Werte besitzen. Manche Erkrankungen können die Heilungschancen nach der Transplantation verschlechtern.Durchführung der Hornhauttransplantation
Die vollständige Hornhautübertragung (perforierende Keratoplastik) kann in Vollnarkose, aber auch in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Die geschädigte Hornhaut des Empfängers wird in einer bestimmten Größe herausgeschnitten. Die Spenderhornhaut wird mit feinen Werkzeugen so zurechtgeschnitten, dass sie genau in die entstandene Lücke passt. Wenn möglich, sollte der Durchmesser zwischen 6,5 und 8,5 Millimeter betragen. Das Hornhautscheibchen wird eingesetzt und mit einer sehr dünnen Naht befestigt. Hierzu können verschiedene Nähtechniken angewendet werden.Bei der sehr selten durchgeführten lamellären Keratoplastik wird nur der vordere Anteil der Hornhaut entnommen und ersetzt, die inneren Gewebeschichten verbleiben. Diese Operation ist meist sogar schwieriger durchzuführen als ein kompletter Ersatz der Hornhaut mittels einer perforierenden Keratoplastik.
Mögliche Komplikationen einer Hornhautübertragung
Verschiedene Anteile des Auges und seiner Umgebung können durch die Operation geschädigt werden. Blutungen sind sehr selten, aber nicht auszuschließen. Infektionen sind möglich. Fäden der Hornhautnaht können sich lockern. Schließt die Hornhaut nicht dicht ab, so müssen meist weitere Fäden gelegt werden. Probleme bei der Einheilung der Hornhaut können sich ergeben, es kann zu (erneuten) Narben oder Hornhauttrübungen kommen. In sehr seltenen Fällen kann es zu einer so starken Schädigung des Auges kommen, dass sich die Sehfähigkeit bedeutend verschlechtert, es zur Blindheit oder zum Verlust des Auges kommt.Wie bei jeder Transplantation mit verschiedenem Spender und Empfänger kann es zu einer Abstoßung des übertragenen Gewebes kommen. Die Gefahr ist allerdings bei Hornhäuten relativ gering, weil sie normalerweise nicht durchblutet sind. Haben sich (z. B. nach Entzündungen oder Verätzungen) auf der Empfängerhornhaut jedoch bereits Blutgefäße gebildet, so ist das Abstoßungsrisiko größer.
Was geschieht nach der Keratoplastik (Hornhauttransplantation)?
Um eine Transplantatabstoßung zu verhindern, müssen Medikamente beziehungsweise Augentropfen zur Unterdrückung von Immunreaktionen, zur Entzündungshemmung sowie zur Verhinderung von Infektionen gegeben werden. Die verordneten Medikamente sollten gewissenhaft angewendet werden.
Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Augenarzt. Auch wenn der Patient im operierten Auge Besonderheiten bemerkt, z. B. ein Fremdkörpergefühl oder Schmerzen, sollte er sich rasch zu einem Augenarzt begeben. Dieser kann dann eine mögliche Abstoßung der transplantierten Hornhaut erkennen.
Die Hornhautfäden werden in aller Regel für 12 Monate belassen, da die übertragene Hornhaut eine verhältnismäßig lange Zeit zum Einheilen benötigt. Erst dann können die Fäden vom Augenarzt vorsichtig herausgezogen werden. Dafür ist in den meisten Fällen eine örtliche Betäubung ausreichend.
Letzte Aktualisierung am 11.09.2009.