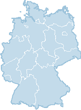CLE (clear lens extraction), Linsenaustausch
Lesezeit: 5 Min.
Wie funktioniert der Austausch einer Linse?
Grundlagen zum Linsenaustausch zur Sehschärfekorrektur
Zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten wird manchmal in einer Operation die natürliche Linse herausgenommen und eine Kunstlinse mit veränderten Werten eingesetzt. Die Maßnahmen entsprechen im Prinzip einer Operation am Grauen Star, mit dem Unterschied, dass keine Trübung der Linse vorliegt. Es wird meist mit dem englischen Begriff Clear Lens Extraction (CLE, Entnahme der klaren Linse) bezeichnet. Das Verfahren wird auch Refraktiver Linsenaustausch genannt.Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen zum Linsenaustausch zur Sehschärfekorrektur
- Welche Arten von Fehlsichtigkeit gibt es?
- Müssen spezielle Voruntersuchungen erfolgen, um eine Clear Lens Extraction durchzuführen?
- Wie wird die Operation zum Linsenaustausch durchgeführt?
- Welche Arten von Linsen können statt der körpereigenen Linse eingesetzt werden?
- Welche Komplikationen können bei der Operation zum Linsenaustausch vorkommen?
- Was muss der Patient nach der Operation beachten?
- Wie sind die Erfolgsaussichten nach einer Clear Lens Extraction (Refraktiver Linsenaustausch)?
- Können die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden?
Welche Arten von Fehlsichtigkeit gibt es?
An einem Auge kann Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder zusätzlich Stabsichtigkeit vorhanden sein. Die Fehlsichtigkeit ist abhängig von der Brechkraft der Hornhaut und Linse und dessen Verhältnis zur Augapfellänge.Kurzsichtigkeit beschreibt den Zustand, bei dem der Patient in der Ferne verschwommen sieht. Das kommt dadurch zustande, dass die Brechkraft der durchsichtigen Medien zu groß ist und der Augapfel dafür zu lang ist. Die parallel auf das Auge treffenden Lichtstrahlen werden schon vor dem Augenhintergrund gebündelt.
Bei Weitsichtigkeit hingegen sieht der Patient in der Nähe unscharf. Der Augapfel ist zu kurz beziehungsweise die Brechkraft von Linse und Hornhaut zu gering.
Stabsichtigkeit liegt dann vor, wenn die Hornhaut in eine Richtung (z. B. von oben nach unten) stärker gekrümmt ist als in die andere (z. B. von links nach rechts). Der Patient sieht einen Punkt als einen Strich.
Der refraktive Linsenaustausch eignet sich auch für hohe Werte der Kurz- und Weitsichtigkeit, die mit anderen Verfahren (z. B. Laseroperationen wie LASIK) nicht mehr behandelbar sind. Auch Stabsichtigkeit ist zu einem gewissen Maße korrigierbar.
Müssen spezielle Voruntersuchungen erfolgen, um eine Clear Lens Extraction durchzuführen?
Die Untersuchungen im Vorfeld eines solchen Eingriffs entsprechen weitgehend denen, die auch vor der herkömmlichen Operation am Grauen Star (Katarakt-Extraktion) durchgeführt werden. Es erfolgt eine Befragung des Patienten (Anamnese) und ein genauer Sehtest, der zunächst ohne und dann mit geeigneter Brillenkorrektur vorgenommen wird. Der Arzt betrachtet Vorderabschnitt des Auges und Augenhintergrund. Dazu ist eine Erweiterung der Pupille durch die Gabe bestimmter Augentropfen erforderlich. Der Augeninnendruck wird bestimmt. Zur Berechnung der optimalen Augenlinse wird eine genaue Vermessung des Auges vorgenommen. Dies geschieht mit Spezialgeräten, z. B. dem IOL-Master® zur so genannten optischen Biometrie.Wie wird die Operation zum Linsenaustausch durchgeführt?
Vor der Operation sollten Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, in Rücksprache mit dem Arzt abgesetzt werden, falls der Patient sie einnimmt. Dazu gehören z. B. Marcumar® und Aspirin®.In der Regel wird eine örtliche Betäubung vorgenommen. Oft wird sie mit einer Spritze neben das Auge (Retrobulbäranästhesie) gegeben, kann aber auch durch Betäubungstropfen erfolgen. Nur manchmal erfolgt eine Vollnarkose. Die Pupille wird durch die Gabe von Augentropfen erweitert.
Der Eingriff erfolgt bei Betrachtung durch ein Operationsmikroskop. Ein Schnitt wird am äußeren Rand der Hornhaut angelegt. Mit einem speziellen Ultraschall-Instrument wird die natürliche Linse weich gemacht. Die Linse kann dann einfach abgesaugt werden (Phakoemulsifikation). Es verbleibt der hintere Kapselsack der Linse. Dort wird dann die Kunstlinse (Intraokularlinse, IOL) eingesetzt. Sie hält in aller Regel von alleine im Kapselsack. Nur selten sind andere Methoden zur Fixierung der Linse erforderlich. Nach dem Eingriff heilt der Hornhautschnitt im Normalfall selbst zu, eine Naht muss nur bei erwarteter Undichtigkeit erfolgen. Am Ende der Operation wird ein Augenverband angelegt.
Alles in allem dauert die Operation zum Austausch der klaren Linse etwa 15 bis 20 Minuten, selten auch länger.
Welche Arten von Linsen können statt der körpereigenen Linse eingesetzt werden?
Die Ersatzlinsen bestehen aus Kunststoff. Materialien, die oftmals zur Herstellung der Linsen verwendet werden, sind vor allem PMMA, Silikon, Acryl sowie Hydrogel. Die Stärke der Linsen wird anhand der Werte, die bei den Voruntersuchungen gemessen wurden, berechnet.Die „normale“ Kunstlinse besitzt eine einheitliche Brechkraft und wird so ausgesucht, dass der Patient entweder in der Ferne oder in der Nähe scharf sieht. Für den jeweils anderen Bereich wird eine Brille benötigt. Gerade bei diesem Eingriff werden jedoch oft auch Linsen eingesetzt, die einen Bereich des scharfen Sehens sowohl in der Nähe als auch in der Ferne besitzen (bifokale oder multifokale Intraokularlinsen). Ebenso sind Linsen entwickelt worden, die die Schärfeeinstellung der natürlichen Linse zwischen Nähe und Ferne bis zu einem gewissen Grad imitieren (akkomodierende Intraokularlinsen).
Welche Komplikationen können bei der Operation zum Linsenaustausch vorkommen?
Im Allgemeinen können die gleichen Komplikationen auftreten wie auch bei der Operation des Grauen Stars. Verschiedene Strukturen können verletzt werden. Blutungen oder Nachblutungen sind selten. Sollte die Hinterkapsel der Linse reißen oder Teile des Glaskörpers nach vorne gelangen, so müssen meist besondere Maßnahmen erfolgen. Durch Abschürfungen der Hornhaut können starke Schmerzen entstehen. Mitunter schwerwiegende Infektionen des Auges können auftreten. Netzhautablösungen, die eine Gefahr für die Sehkraft des Auges darstellen, können manchmal vorkommen. Gefährdet für eine Netzhautablösung sind besonders kurzsichtige Augen. Der Augendruck kann steigen, wodurch weitere Schäden entstehen können. Bei Flüssigkeitsansammlungen in der Netzhautmitte (Makula) kann es zu Sehverschlechterungen kommen. Nicht selten entstehen nach der Operation Trübungen der Linsenkapsel (so genannter Nachstar). Mit einem einfachen Lasereingriff können diese meist beseitigt werden. Bisweilen verrutscht die Linse im Auge, und eine weitere Operation wird notwendig. In Ausnahmefällen wird die Linse vom Körper abgestoßen. Eine dauerhafte Sehverschlechterung, Erblindung oder im äußersten Fall der Verlust des Auges sind nicht auszuschließen.Was muss der Patient nach der Operation beachten?
Wenn der Eingriff ambulant erfolgt, so sollte sich der Patient abholen lassen. Er darf vor allem in den ersten 24 Stunden nicht selbst Auto fahren.Am Tag nach dem operativen Linsenaustausch führt der Augenarzt eine Kontrolluntersuchung durch. Es wird vor allem ein Sehtest, eine Augendruckmessung und eine Begutachtung des Auges und der eingesetzten Linse durchgeführt. Der Verband kann von diesem Zeitpunkt an in der Regel weggelassen werden. Der Patient sollte dennoch vorsichtig mit dem Auge umgehen, beispielsweise nicht daran reiben. Ebenfalls sollte er nicht schwimmen gehen oder sich körperlich anstrengen. Die Augentropfen, die der Arzt verschrieben hat, sollten nach Plan angewendet werden.
Wie sind die Erfolgsaussichten nach einer Clear Lens Extraction (Refraktiver Linsenaustausch)?
Dadurch, dass die komplette Augenlinse ausgetauscht werden kann, können auch sehr hohe Werte der Kurz- und Weitsichtigkeit durch entsprechende Veränderung der Brechkraft ausgeglichen werden. Dies ist mit den anderen Verfahren (z. B. Laserbehandlungen der Hornhaut wie LASIK) in diesem Ausmaß nicht möglich. In vielen Fällen kann die Fehlsichtigkeit so behandelt werden, dass eine Brille nur noch für die Nähe oder die Ferne notwendig ist oder komplett weggelassen werden kann. Eine Garantie für einen Behandlungserfolg kann jedoch nicht gegeben werden. Die Komplikationsrate ist etwas höher als bei Verfahren wie der LASIK. Es handelt sich bei der Clear Lens Extraction (beziehungsweise der Operation des Grauen Stars) allerdings um einen schon seit langer Zeit routinemäßig vorgenommenen Eingriff, der sehr häufig durchgeführt wird und dessen Risiken und Folgen genau bekannt sind.Können die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden?
Für eine Operation, die nur der Behandlung von Fehlsichtigkeiten dient, werden in aller Regel von den Krankenversicherungen die Kosten nicht übernommen. Manchmal liegt aber eine medizinische Begründung für den Eingriff vor, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Krankenversicherung zumindest einen Teil der Kosten trägt. Hier sollte sich der Patient genau erkundigen.Letzte Aktualisierung am 23.03.2023.